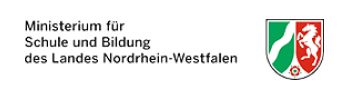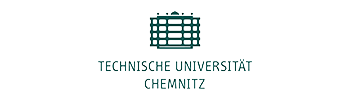Ableiten
In der Rechtschreibdidaktik eine Strategie zur Berücksichtigung des Morphemprinzips, indem die Grundform eines Wortes gesucht wird: „läuft“ nicht mit <eu>, sondern mit <äu> wegen der Grundform „laufen“. Das Ableiten bzw. die Grundformbildung ist auch wichtig beim Nachschlagen: „Grauwal“ wird bei „Wal“ gesucht, „war“ bei „sein“. Das erfordert viel Übung.
Alphabetische Strategie
Die alphabetische Phase ist Teil des Schriftspracherwerbs. In dieser Phase erlangt das Kind Einsicht in den Zusammenhang von Schrift und Laut. Zu diesem Entwicklungszeitpunkt schreiben die Kinder lautgetreu bzw. umgangssprachlich (z.B. „Tiga“ statt Tiger).
Anfangsunterricht
Anfangsunterricht ist ein in spezifischer Art und Weise gestalteter Unterricht für Schulanfänger und Schulanfängerinnen, der an besondere organisatorische, pädagogische und didaktische Anforderungen geknüpft ist. Im Mittelpunkt des Anfangsunterrichts steht die Vermittlung der Lese- und Schreibfertigkeit.
Anlautidentifizierung
Als Anlautidentifizierung (Identifizierung = Herausfinden) wird der Prozess des Erkennens der Anfangslaute von Wörtern bezeichnet. Dies ist eine notwendige phonemanalytische Fähigkeit, um Wörter schreiben zu können. Beispielsweise müssen die Kinder heraushören können, dass das Wort „Tanne“ mit dem Phonem /t/ und „Kanne“ mit /k/ beginnt und dass dafür die Buchstaben <t> und <k> verwendet werden müssen.
Anlauttabelle
(auch Schreibtabelle, Lauttabelle, Buchstabentabelle) Die Anlauttabelle bildet die Basis für das selbstständige Schreiben im Anfangsunterricht: Auf einer Übersicht ist zu (jedem) Graphem ein Objekt abgebildet, das den repräsentierten Laut am Wortanfang enthält. Anlauttabellen bieten Kindern eine frühe Möglichkeit, sich schriftsprachlich auszudrücken.
Arbeitsgedächtnis
Das phonologische Arbeitsgedächtnis hat die Aufgabe, sprachliche Informationen zu speichern und weiterzuverarbeiten. Die einzelnen Grapheme werden auf der Grundlage der gelernten Graphem-Phonem-Korrespondenz-Regeln in Laute „übersetzt“. Um die Einzellaute zu einem Wort zu synthetisieren, müssen die bereits verarbeiteten Buchstaben in phonologischer Form im Arbeitsgedächtnis zwischengespeichert werden, während die folgenden Buchstaben gleichzeitig rekodiert, also verarbeitet werden (Verarbeitungsprozess).
Automatisierung
Automatisierung der Wort- und Satzerkennung: Es wird nicht mehr Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort gelesen. Automatisierung bedeutet müheloses Lesen bei geübten Leserinnen und Lesern. Somit wird das Arbeitsgedächtnis entlastet und Textverständnis gelingt.
Automatisierung der Worterkennung
Durch die Automatisierung der Wort- und Satzerkennung wird nicht mehr Buchstabe für Buchstabe oder Wort für Wort gelesen. Stattdessen werden bekannte Wörter schnell und flüssig basierend auf einen Eintrag im orthographischen Lexikon erkannt, sodass keine systematische Buchstabe-Laut-Übersetzung erfolgen muss.
Automatisierung bedeutet daher müheloses Lesen bei geübten Leserinnen und Lesern. Somit wird das Arbeitsgedächtnis entlastet und das Textverständnis gelingt.
Basisgraphem
Unter dem Basisgraphem versteht man den Buchstaben, der für ein bestimmtes Phonem am häufigsten verwendet wird. So wird das Phonem /f/ am häufigsten durch das <f> und nur in einigen wenigen Fällen durch <v> wiedergegeben. Das Phonem /a:/ wird in 89,8% der Fälle als <a> wiedergegeben. Das Basisgraphem für ein /a:/ ist also das <a>. Es ist ausreichend, wenn auf der Anlauttabelle zu jedem Phonem das Basisgraphem abgebildet wird. Eine Besonderheit unter den Basisgraphemen ist <ie> für das lange /i:/, weil es statistisch häufiger ist, während aus der Perspektive der Lernenden das <i> bekannter ist als das Digraphem <ie>, auch wegen des Buchstabennamens „I“ für <i>. Sogenannte Orthographeme sind hingegen Grapheme, die seltener geschrieben werden.
Benennungsgeschwindigkeit
Die Benennungsgeschwindigkeit bezeichnet die Fähigkeit, (erstens) mehrere sichtbare Bilder oder Symbole möglichst schnell visuell zu verarbeiten und zu identifizieren sowie (zweitens) daraufhin die entsprechenden phonologischen Repräsentationen im mentalen Lexikon zu aktivieren und (drittens) das entsprechende Wort (oder den entsprechenden Laut) basierend auf einem artikulatorisch-motorischen Plan zu artikulieren. Zum Beispiel kann bestimmt werden, wie schnell ein Kind mit dem Bild eines Apfels das Wort „Apfel“ abrufen kann. Von der Benennungsgeschwindigkeit lassen sich Rückschlüsse auf mögliche Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb ziehen. Sie gehört zu den Vorläuferfähigkeiten des Schriftspracherwerbs und steht vor allem in engem Zusammenhang mit der Lesegeschwindigkeit und der automatisierten Worterkennung.
Beobachtung
(auch Lernbeobachtung) (Lern-)Beobachtung ist ein pädagogisches Verfahren, das der Lehrperson Einblick über die individuellen Lernstände der Kinder ermöglicht, d.h., über die Einzelleistungen, Strategien und Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Es sollte dialogisch angelegt sein, um die Fähigkeit der Kinder zur Selbstein-
schätzung ihres Könnens und Wissens zu fördern.
Dekodieren/Dekodierfähigkeit
Dekodieren bezeichnet das Zuordnen von Buchstaben oder Buchstabengruppen zu Lauten oder Lautfolgen sowie das Erkennen von Wortbausteinen, Wörtern und Wortbedeutungen. Grundlage dafür sind Wahrnehmung und Unterscheidung von einzelnen Buchstaben bis hin zum gelesenen Wort. Ein Kind liest z.B. „Butteeer“ und wiederholt dann im Sinne des Verstehens „Butta“ mit dem unbetonten e in
der letzten Silbe.
Diagnostik/Diagnose
Diagnostik bezeichnet den Prozess der Erkennung, Identifizierung und Bewertung von Zuständen, Symptomen oder Problemen bei einer Person. In der Regel dient die Diagnostik dazu, eine gezielte Intervention zu planen und umzusetzen.
Early Literacy
Aus dem Englischen: literacy = die Fähigkeit, Lesen und Schreiben zu können und mit geschriebener Sprache umzugehen
Mit dem Konstrukt Early Literacy sind frühe Erfahrungen mit Schriftsprache gemeint. Beispiele sind Bilderbuchbetrachtungen oder die Auseinandersetzung mit Beschriftungen, etwa Schildern, im Kleinkindalter. Early Literacy kann in der Familie, aber auch im institutionellen Kontext wie in der Kindertagesstätte stattfinden. Early Literacy-Erfahrungen fördern den späteren Lese- und Rechtschreiberwerb.
Frikativ
Frikative sind eine Artikulationsart für Konsonanten, bei denen der Luftstrom durch eine Verengung im Mund- oder Rachenraum gehemmt wird, wobei ein reibendes Geräusch entsteht. Daher werden Frikative auch Reibelaute genannt. Die Frikative /z/, /s/ und /ʃ/, bei denen der Luftstrom durch eine Längsrille in der Zunge geführt wird und mit einem zischenden Geräusch einhergeht, werden auch Zischlaute oder Sibilanten genannt. Zu den Frikativen zählen die stimmhaften Konsonanten /v/ („Wind“), /z/ („Sonne“) sowie die stimmlosen Konsonanten /f/ („Fisch“), /s/ („Fuß“), /ʃ/ („Schule“), /ç/ („Chemie“), /x/ („Dach“) und /h/ („Hose“).
Gendersensibles Lesen
Gendersensibles Lesen bedeutet, bewusst darauf zu achten, wie in Texten mit Geschlechterstereotypen umgegangen wird und diese zu hinterfragen. Es geht darum, die verschiedenen Geschlechter in Texten gleichberechtigt und inklusiv zu berücksichtigen, indem beispielsweise genderneutrale Formulierungen oder geschlechtergerechte Sprache verwendet werden. Ziel ist es, eine diskriminierungsfreie und vielfältige Sprache zu fördern und somit eine offene und tolerante Gesellschaft zu unterstützen.
Globale Kohärenz/lokale Kohärenz
Kohärenz bezeichnet das Erstellen eines inhaltlichen Zusammenhangs zwischen verschiedenen Textteilen.
- Beispiel: „Es regnet. Ich brauche einen Regenschirm.“
In den beiden Sätzen werden keine sprachlichen Mittel verwendet, die einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen ihnen herstellen. Dennoch kann zwischen den Sätzen eine Verbindung hergestellt werden: Der Grund für das Mitnehmen eines Regenschirms ist der Regen.
Graphem
Grapheme sind in der Linguistik die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten der Schrift, tragen jedoch nicht selber Bedeutung (z.B. „wagen“ <w> – „tagen“ <t>). Sie werden in spitzen Klammern (< >) geschrieben. Besonderheiten sind:
- Ein Graphem kann aus mehreren Buchstaben bestehen; mehrteilige Grapheme
sind z. B. <ei>, <sch>, <mm>, <ie>. - Einem Graphem können ein oder mehrere Phoneme entsprechen: Beispielsweise
entspricht dem Graphem <o> das Phonem /o:/ in „Ofen“ und das Phonem /ᴐ/
in „offen“; dem Graphem <v> entspricht das Phonem /f/ wie in „Vater“ und das
Phonem /w/ wie in „Vase“.
Graphem-Phonem-Korrespondenz
In der Linguistik ist dies der Zusammenhang zwischen bedeutungsunterscheidenden Schrift- und Sprachzeichen; genauer: welchem Graphem beim Lesen welche Phoneme zugeordnet werden können. Die Graphem-Phonem-Korrespondenz ist im Deutschen keine 1:1-Beziehung: Das Graphem <a> korrespondiert z. B. mit den Phonemen /a/ und /a:/ (mehrdeutige Graphem-Phonem-Korrespondenz). Wichtige mehrdeutige Graphem-Phonem-Korrespondenzen sind in Schreibtabellen bildlich dargestellt, vor allem bei Vokalen. Die mehrdeutige Graphem-Phonem-Korrespondenz ist eine Schwierigkeit beim Lesenlernen, umgekehrt ist die mehrdeutige Phonem-Graphem-Korrespondenz eine Schwierigkeit beim Schreibenlernen.
Gütekriterien
Die Gütekriterien „Objektivität, Validität, Reliabilität“ werden in der Klassischen Testtheorie angewendet, um Daten oder Instrumente auf ihre Wissenschaftlichkeit zu prüfen. Entspricht etwas den Gütekriterien, so ist seine Wirksamkeit überprüft, evaluiert und getestet worden. Die Gütekriterien geben den theoretischen Rahmen zur Überprüfung. Die Validität beschreibt die inhaltliche Gültigkeit der Ergebnisse der Testungen. Die Reliabilität sichert ab, wie zuverlässig und genau die Messungen sind, während die Objektivität die Unabhängigkeit der Untersuchung von der testenden Person misst.
Handlungs- und produktionsorientierter Ansatz
Der handlungs- und produktionsorientierte Ansatz ist ein pädagogischer Ansatz, der sich darauf konzentriert, Lernende aktiv in den Lernprozess einzubeziehen. Dabei steht nicht nur das Wissen im Vordergrund, sondern auch dessen Anwendung und Umsetzung in praktischen Projekten. In diesem Ansatz werden die Lernenden dazu ermutigt, eigene Ideen und Projekte zu entwickeln und umzusetzen, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten anzuwenden und zu vertiefen.
Hierarchieniedrige und hierarchiehohe Prozesse
Hierarchieniedrige Prozesse
Die hierarchieniedrigen Prozesse der Lesekompetenz sind Teil der Leseverstehensleistung. Sie umfassen das Rekodieren und das Dekodieren von Wörtern sowie die angemessene Lesegeschwindigkeit und die sinngemäße Intonation. Man fasst diese Prozesse auch als Leseflüssigkeit zusammen.
Hierarchiehohe Prozesse
Die hierarchiehohen Prozesse der Lesekompetenz sind Teil der Leseverstehensleistung. Wenn die hierarchieniedrigen Prozesse automatisiert sind, können die hierarchiehohen Teilfertigkeiten ungestört ablaufen. Dazu zählen vor allem das sinnerfassende Lesen, das Herstellen globaler Kohärenz sowie das allgemeine Leseverstehen und die Anwendung von Lesestrategien. Kompetente Leserinnen und Leser sind in der Lage, auch über den Text hinaus zu denken, ihr eigenes Vorwissen einzubeziehen und Schlussfolgerungen aus dem Gelesenen zu formulieren.
Inferenzen
Inferenzen sind Schlussfolgerungen, die aus gegebenen Informationen gezogen werden, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei werden oft logische Schlüsse gezogen, um Rückschlüsse auf unbekannte Fakten oder Zusammenhänge zu ziehen.
Integrationsphase
Die Integrationsphase ist Teil des Konstruktions- und Integrationsprozesses. In ihr werden die einzelnen Aussagen und Assoziationen zusammengeführt und Unwichtiges wird herausgefiltert. Der Textinhalt wird als mentales Modell abgespeichert und Verbindungen zwischen größeren Texteinheiten werden hergestellt. Dies bezeichnet man als globale Kohärenz.
Interaktionistische Modelle
Interaktionistische Modelle beschreiben die Entstehung menschlichen Verhaltens als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen individuellen Eigenschaften und sozialen Umständen. Sie betonen die Bedeutung der Interaktion zwischen Individuen und ihrer Umgebung, wobei die individuelle Erfahrung und das Verhalten als Ergebnis dieser Interaktionen betrachtet werden.
Interpunktion
Interpunktion ist die Verwendung von Satzzeichen in einem Text, um dessen Bedeutung und Lesbarkeit zu verbessern. Dabei werden verschiedene Satzzeichen wie Punkt, Komma, Semikolon oder Fragezeichen verwendet, um die syntaktischen und semantischen Strukturen des Textes zu markieren.
Koartikulation
Die Koartikulation beschreibt das Ineinandergreifen der Artikulationsbewegungen, wenn innerhalb des Sprechablaufs verschiedene Laute nacheinander artikuliert werden müssen. Der zu artikulierende Laut wird dann durch den vorangehenden oder den nachfolgenden Laut beeinflusst. Die Artikulationswerkzeuge müssen sich an die Lautkombinationen anpassen, indem sich die Artikulatoren (z.B. Zunge oder Lippen) während der Bildung des erstens Lautes in die Position des nachfolgenden begeben.So klingt der Laut /k/ beispielsweise mit nachfolgendem /i/ (vorderer ungerundeter Vokal) anders als mit nachfolgendem /u/ (hinterer gerundeter Vokal).
Kohäsion/Kohäsionsmittel
Kohäsion bezeichnet den formalen Zusammenhalt eines Textes, welcher durch Kohäsionsmittel erzeugt wird. Unter Kohäsionsmitteln werden in der Linguistik sprachliche Mittel verstanden, mit denen Beziehungen zwischen Wörtern, Satzteilen und Sätzen ausgedrückt werden.
- Beispiel: „Ich brauche einen Regenschirm, weil es regnet.“Mit der Konjunktion „weil“ werden die beiden Aussagen „Ich brauche einen Regenschirm.“ und „Es regnet.“ miteinander verknüpft.
Langzeitgedächtnis
Das Langzeitgedächtnis ist ein Gedächtnissystem, in dem eine große Menge verschiedener Informationen über einen längeren Zeitraum gespeichert werden. Um dort einsortiert zu werden, müssen Informationen wie Faktenwissen, Erinnerungen oder Fähigkeiten als relevant eingestuft und vom Ultrakurzzeitgedächtnis ins Kurzzeitgedächtnis sowie von dort ins Langzeitgedächtnis vermittelt werden.
Lautleseverfahren/Leiseleseverfahren
(auch Lautlesetraining) Lautleseverfahren werden eingesetzt, um durch wiederholendes (halb-)lautes Lesen eines Textes die Leseflüssigkeit zu üben.Unterschieden werden verschiedene Methoden zum rein kognitiven Training, z.B. das Tandemlesen, Mitlesen beim Hörbuchhören und chorisches Lesen in der Klasse. Zur Unterstützung von Zugängen zu Schriftkultur sollten Kinder den Text sowie Lesepartnerinnen und Lesepartner selbst auswählen.
Leiseleseverfahren sind Leseübungen, bei denen der Text stumm gelesen wird, um das Verständnis und die Konzentration zu fördern. Durch leises Lesen können Leserinnen und Leser sich besser auf den Inhalt konzentrieren und sind weniger abgelenkt.
Lern-/Prozessdiagnostik
auch: Lernverlaufsdiagnostik Die Lernprozessdiagnostik verfolgt den Entwicklungsprozess eines Kindes. Es werden nicht zu einem einzelnen Zeitpunkt Daten erhoben, sondern in regelmäßigen, zeitlich kurzen Abständen. Es lassen sich so nicht nur individuelle Fördermaßnahmen entsprechend anpassen, sondern auch der Impact des Unterrichts kann überprüft und gegebenenfalls verändert werden. Die pädagogische Fachkraft hat zu jedem Zeitpunkt einen präzisen Überblick in den Kenntnisstand, die Fortschritte und die (Lern-)Schwierigkeiten des Kindes. Es gibt verschiedene Instrumente, mit denen eine Lernverlaufsdiagnostik erstellt werden kann.
Leseflüssigkeit
Bezeichnet in der Leseforschung die Fähigkeit, einen altersangemessenen Text genau, automatisiert, angemessen schnell und mit Betonung zu lesen. Weil die Aufmerksamkeit beim flüssigen Lesen auf größere Einheiten und nicht mehr auf den Prozess des Erlesens gerichtet ist, bleibt mehr kognitive Kapazität für den Textinhalt. Leseflüssigkeit ist derzeit ein zentrales Anliegen zur Leseförderung in der Grundschule, weil sie als Brücke zum Textverstehen und zur Lesekompetenz gilt. Dass wir lateinische Texte flüssig lesen können, ohne sie zu verstehen, ist jedoch ein Hinweis darauf, dass mit der Leseflüssigkeit nicht automatisch auch das Textverstehen steigt. Leseverstehen muss also auch bei flüssigem Lesen bzw. parallel gefördert werden.
Lesekompetenz
Lesekompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, einen Text zu erlesen, zu verstehen, zu analysieren und zu bewerten. Sie umfasst sowohl das Verständnis des Textinhalts als auch die Fähigkeit, Informationen aus dem Text zu extrahieren und die Inhalte kritisch zu reflektieren.
Lesekultur
Lesekultur bedeutet eine langfristige und stabile Verankerung des Lesens in der Alltagskultur der Schülerinnen und Schüler.
Leserituale
Leserituale sind festgelegte Gewohnheiten, die beispielsweise für die ganze Klasse eingerichtet und regelmäßig durchgeführt werden. Ein Beispiel dafür ist eine feste Lesezeit. Über einen bestimmten Zeitraum liest die Lehrkraft jeden Morgen vor oder die Schülerinnen und Schüler erhalten täglich zwanzig Minuten individueller stiller Lesezeit. Weitere Möglichkeiten sind z.B. ein wöchentlicher Besuch in der Bibliothek und eine monatliche Lesenacht.
Leseselbstkonzept
Das lesebezogene Selbstkonzept sagt aus, wie Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Fähigkeiten in Bezug auf das Lesen einschätzen und als was für eine Leserin bzw. einen Leser sie sich selbst einstufen. Das Leseselbstkonzept ist einer der Prädiktoren der Lesekompetenz.
Lesesozialisation
Die Lesesozialisation bezeichnet den Prozess, in dem Kinder sich mit literarischen Medien auseinandersetzen sowie in die Schrift- und literarische Kultur hineinzuwachsen. Auf der einen Seite werden die Kinder durch die vorhandenen literalen Praktiken geprägt, auf der anderen Seite kann die eigene Lesesozialisation auch durch das Individuum beeinflusst werden.
Leseverstehen
Leseverstehen ist die Fähigkeit, einzelne Wörter, Sätze und Texte flüssig zu lesen und den Inhalt im Gesamtzusammenhang zu verstehen (reading literacy). Der Inhalt muss auf Basis der Informationen aus dem Text und auf Grundlage des eigenen Vorwissens eingeordnet werden. Es entsteht ein Mentales Modell, d.h., die Schülerinnen und Schüler können sich vorstellen, worum es im Text geht.
Lesevorbild
Lesevorbilder können alle Personen im schulischen und privaten Umfeld der Kinder sein, welche die Entwicklung ihres Leseselbstkonzeptes beeinflussen. Dabei spielt es beispielsweise eine Rolle, ob die Eltern als mögliche Lesevorbilder selbst einen Bezug zur Schriftsprache haben und inwiefern es eine Lesekultur im häuslichen, aber auch im generellen privaten Umfeld des Kindes gibt.
Lexem
Lexem bezeichnet die lautliche (und schriftliche) Form eines Wortes, die im mentalen Lexikon gespeichert ist. Hierzu zählen phonologische Informationen, z. B. der Klang und die Silbenstruktur des Wortes, sowie morphologische Informationen, z. B. die Morphemstruktur. Daraus können äußere formale Eigenschaften entnommen werden, die das auditive Bild (und das Schriftbild) eines Wortes charakterisieren.
- Beispiel: „Das Wort ‚gespielt‘ besteht aus zwei Silben und aus den Morphemen ‚ge-‘, ‚spiel‘ und ‚t‘.“
Lexikalisch
Als lexikalisch werden alle linguistischen Aspekte bezeichnet, die sich auf den Wortschatz beziehen.
Liquid
Liquide (auch Fließlaute, Schmelzlaute) sind eine Artikulationsart für Konsonanten, bei der ein fließender Charakter erkennbar ist. Hauptsächlich werden die Laute /r/ und /l/ dadurch charakterisiert.
Literarisches Lesen
Literarisches Lesen bezieht sich auf das Lesen literarischer Texte wie Romane, Gedichte oder Theaterstücke, die sich durch ihre literarische Qualität und künstlerische Ausdrucksweise auszeichnen. Literarisches Lesen steht dem Lesen von Sachtexten bzw. nicht fiktionalen Texten gegenüber.
Literaturdidaktische Ansätze
Literaturdidaktische Ansätze beziehen sich auf verschiedene Konzepte und Methoden, die in der Vermittlung von Literatur angewendet werden. Sie zielen darauf ab, dass Schülerinnen und Schüler ein umfassendes Verständnis von Literatur entwickeln. Beispiele dafür sind: der hermeneutische Ansatz, der textanalytische Ansatz sowie der handlungs- und produktionsorientierte Ansatz.
Literaturunterricht
Der Literaturunterricht ist in den Lehrplänen aller Bundesländer als wichtiger Bestandteil der Kompetenzausbildung von Kindern und Jugendlichen verankert. Er soll didaktische Zugänge zu Schriftsprache sowie zu Büchern und Texten bieten. Zentrale Unterrichtsziele sind Texterschließung, Textverstehen und Anschlusskommunikation. Der Literaturunterricht soll zudem Erfahrungs- und Reflexionsräume über Literatur bieten. Dazu gibt es verschiedene literaturdidaktische Ansätze.
Mehrsprachigkeit
Mehrsprachigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, mehr als eine Sprache zu verstehen und/oder zu verwenden.
Mentales Lexikon
Das mentale Lexikon beschreibt den gesamten Wortschatz einer Person, der im Gehirn repräsentiert ist und auf den zugegriffen werden kann. Das mentale Lexikon ist eine Art „Wörterbuch“, das alle Wörter enthält, die eine Person kennt und gebraucht. Zu den jeweiligen Wörtern im mentalen Lexikon werden verschiedene Informationen gespeichert, wie die phonologische Gestalt, die morphologische Struktur, die syntaktische Kategorie und die Verbindung zur Wortbedeutung. Gespeicherte Einträge im mentalen Lexikon können ständig weiter ausgebaut, verändert und miteinander vernetzt werden. Daher ist das mentale Lexikon ein komplex strukturiertes und dynamisch verwendbares neuronales Netzwerk, das notwendig für den Wortschatzerwerb und -gebrauch ist.
Mentales Modell
Das Mentale Modell bezieht sich auf die kognitive Struktur, die eine Person verwendet, um Informationen zu verstehen, zu interpretieren und zu organisieren. Es kann als eine Art von internem Abbild oder Vorstellung von externen Objekten, Ereignissen oder Prozessen betrachtet werden.
Modell der Lesekompetenz nach Rosebrock & Nix
Der Erwerb der Lesekompetenz wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst und spielt sich auf unterschiedlichen Ebenen ab. Das Modell der Lesekompetenz nach Rosebrock & Nix stellt die Ebenen für den Erwerb dar. Demnach wird Lesekompetenz durch Prozesse beeinflusst, die auf der Prozess-, Subjekt- und der sozialen Ebene angesiedelt sind. Sie betreffen die Kognition des Individuums, sprechen seine Persönlichkeit und Identität an und sind situativ in soziale Situationen eingebettet.
Morphem
Ein Morphem ist der kleinste Teil der Sprache, der eine Bedeutung trägt. Morpheme sind essentiell für Wortbildungsprozesse. Es gibt Basis- bzw. Stammmorpheme, die den inhaltstragenden Teil eines Wortes bilden (z.B. „spiel-“). Außerdem gibt es Flexionsmorpheme, die die grammatische Funktion bestimmen und den Basis- bzw. Stammmorphemen vorangestellt (Präfixe, z.B. „ge-“) und/oder angefügt werden (Suffixe, z.B. „-en“).
- Beispiel: „gespielt“
„spiel-“ (Basis- bzw. Stammmorphem)
„ge-“ und „-t“ (Flexionsmorpheme)
Multimodale Texte
Multimodale Texte beinhalten verschiedene Modalitäten wie Bilder, Graphiken, Videos, Ton oder Animationen. Sie werden genutzt, um Informationen zu vermitteln und Bedeutung zu erzeugen.
Multimodale Texte erfordern von Lesenden oder Betrachtenden, dass diese Informationen aus verschiedenen Modalitäten aufnehmen und verarbeiten können. Der Einsatz multimodaler Texte kann das Verständnis und die Lesekompetenz fördern, da sie den Leserinnen und Lesern eine Vielzahl von Informationen und Perspektiven bieten.
Nasal
Nasale sind eine Artikulationsart für Konsonanten, bei denen der Luftstrom durch den Mundschluss oder durch den Zungenverschluss blockiert wird und die Luft durch die Nase entweicht. Zu den Nasalen zählen die stimmhaften Konsonanten /m/ („Mund“), /n/ („Nase“) und /ŋ/ („Ring“).
Objektivität
In der Klassischen Testtheorie neben der Validität und Reliabilität ein Kriterium für die Testqualität: Ein Test ist objektiv, wenn die subjektiven Interpretationen und Interaktionen von testenden Personen mit Getesteten keinen Einfluss auf das Ergebnis haben. Man unterscheidet Durchführungs-, Ausführungs- und Interpretationsobjektivität.
Orthographische Repräsentation
Orthographische Repräsentationen umfassen die Regeln der Schreibweise, Interpunktion und Groß- und Kleinschreibung in einer Sprache. Diese Repräsentationen sind entscheidend für die korrekte Verwendung von Schriftsprache und für die effektive Kommunikation in der schriftlichen Form.
Orthographisches Lexikon
Ein orthographisches Lexikon ist ein Nachschlagewerk, das die richtige Schreibweise von Wörtern einer Sprache beschreibt. Es ist in der Regel alphabetisch geordnet und enthält für jedes Wort die korrekte Rechtschreibung sowie gegebenenfalls Informationen zur Grammatik und Bedeutung. Orthographische Lexika sind für Schreibende ein wichtiges Hilfsmittel, um Rechtschreibfehler zu vermeiden und eine korrekte Schreibweise zu gewährleisten.
Peers
Als Peers werden zumeist gleichaltrige Kinder und Jugendliche bezeichnet, die sich in derselben Zone der nächsten Entwicklung befinden und vor gleichen Entwicklungsaufgaben stehen. Sie sind häufig als Gruppe durch emotionale Nähe gekennzeichnet.
Phonem
Phoneme sind die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten einer gesprochenen Sprache. Sie sind abstrakte Einheiten, also von der individuellen Artikulation unabhängige Prototypen, und werden in Schrägstrichen (/ /) wiedergegeben. Im Deutschen können einem Phonem beim Schreiben meist mehrere Grapheme zugeordnet werden. So können dem Phonem /a:/ die Grapheme <a> wie in „Tal“, das Graphem <ah> wie in „Zahn“ oder das Graphem <aa> wie in „Saal“ zugeordnet werden. Die Mehrdeutigkeit der Phoneme ist eine Schwierigkeit für das Schreibenlernen.
Phonem-Graphem-Korrespondenz
Die Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK) ist der Zusammenhang zwischen bedeutungsunterscheidenden Schrift- und Sprachzeichen. Dadurch wird beschrieben, welchem Graphem beim Lesen welche Phoneme zugeordnet werden können. Die Graphem-Phonem-Korrespondenz ist im Deutschen keine Eins-zu-eins-Beziehung: Das Graphem <a> korrespondiert z.B. mit den Phonemen /a/ und /a:/ (= mehrdeutige Graphem-Phonem-Korrespondenz).
Phonemsegmentation
Als Phonemsegmentation wird die Zerlegung von Wörtern in Laute bezeichnet. Beispielsweise ist es notwendig, dass Kinder das Wort „Sofa“ unter anderem in die Phoneme /z/, /o/, /f/ und /a/ gliedern können.
Phonemsynthese
Als Phonemsynthese wird die koartikulatorische Verschmelzung von Einzellauten zu einem vollständigen Wort bezeichnet. Hierbei müssen beispielsweise die Phoneme /z/ und /o/ /f/ und /a/ zu /zofa/ zusammengefügt werden, um das Wort „Sofa“ lesen zu können.
Phonologische Bewusstheit
Die phonologische Bewusstheit wird unterteilt in die Bewusstheit ...
- im weiteren Sinne: die Fähigkeiten, Silben zu segmentieren und Silben zu einem Wort zusammenfügen.
- im engeren Sinne: die Fähigkeit, Anlaute zu identifizieren, Laute zu einem Wort zusammenzufügen und ein Wort in seine Laute zu zerlegen.
Phonologische Defizithypothese
Die phonologische Defizithypothese besagt, dass der Schriftspracherwerb durch ein phonologisches Defizit erschwert wird. Das bedeutet, dass den meisten Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb Probleme mit der bewussten Identifizierung und Verarbeitung von Informationen über die Lautstruktur der Sprache sowie deren Speicherung und Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis und dem schnellen und automatisierten Zugriff auf phonologische Repräsentationen im Langzeitgedächtnis zugrunde liegen.
Phonologische Informationsverarbeitung
Phonologische Informationsverarbeitung ist die Fähigkeit, Informationen über die Lautstruktur der gesprochenen sowie geschriebenen Sprache zu erkennen, zu speichern und zu verarbeiten. Ermöglicht wird dies durch die phonologische Bewusstheit, das phonologische Arbeitsgedächtnis sowie die Benennungsgeschwindigkeit.
Phonologische Repräsentationen
Phonologische Repräsentationen sind Informationen über Laute und deren Beschaffenheit, die im phonologischen Lexikon gespeichert werden. Beispielsweise wird festgehalten, wie die phonologische Beschaffenheit eines Lautes in Bezug auf seine Stimmhaftigkeit ist.
Phonologisches Lexikon
Ein phonologisches Lexikon ist ein Bestandteil des mentalen Wortschatzes, in dem jedes Wort durch seine Lautstruktur repräsentiert ist. Es enthält Informationen darüber, welche Laute in welcher Reihenfolge in einem Wort vorkommen und wie sie ausgesprochen werden. Das phonologische Lexikon spielt eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung und Produktion von Sprache und ist ein zentraler Bestandteil des Sprachsystems im Gehirn.
Pragmatische Bewusstheit
Die pragmatische Bewusstheit ist die Fähigkeit, den eigenen Sprachgebrauch in der Kommunikation mit anderen bewusst zu gestalten, z.B. auf die Verständlichkeit einer Mitteilung zu achten und über die situative Angemessenheit einer sprachlichen Äußerung zu reflektieren.
Profilanalyse
Die Profilanalyse ist ein Diagnoseinstrument, um ressourcenschonend die grammatische Komplexität mündlicher und schriftlicher Äußerungen von Kindern beurteilen zu können. Die Profilanalyse untersucht die Struktur von Äußerungen auf Satzebene. Anhand der syntaktischen Komplexität werden sogenannte “Profile” angelegt, denen die Kinder zugeordnet werden. Es lassen sich so aktuelle Sprachstände und notwendige nächste Schritte in der Förderung definieren. Die Profilanalyse im deutschen Sprachgebrauch wurde maßgeblich von Wilhelm Grießhaber (2013) geprägt und kommt vorwiegend im DaZ-Bereich zum Einsatz.
Prosodie
Die Prosodie beschreibt Ausdrucksmerkmale von Sprache. Als prosodische Eigenschaften gelten alle Merkmale oberhalb der Phonemebene, beispielsweise Wort- und Satzakzente (Betonungen), Tonhöhe im Satz, Intonation und Satzmelodie, Tempo, Rhythmus und Pausen beim Sprechen.
RAN (Rapid Automatized Naming)
RAN (Rapid Automatized Naming) ist ein Testverfahren, um die Geschwindigkeit und Effizienz zu messen, mit der benannte visuelle Informationen, wie z.B. Farben oder Objekte, verarbeitet werden.
Rekodieren
Rekodieren bezeichnet die Umwandlung von einer visuellen orthographischen Struktur in Lautsprache. Oftmals führt diese Rekodierung nicht zur korrekten Artikulation, sondern zu einem Wortvorentwurf. Dann ist ein Abgleich mit dem inneren Lexikon erforderlich, um das Wort zu verstehen, d.h., zu dekodieren.
Schreibkonferenzen
Die Schreibkonferenz ist eine Methode für den Schreibunterricht. Kinder stellen dabei eigene Texte einer Gruppe von Lernenden vor. Die anderen geben Hinweise für die Überarbeitung des Textes. Im deutschsprachigen Raum setzte Gudrun Spitta in den 1990er Jahren die Methode ein und entwickelte auf dieser Grundlage ein schreibdidaktisches Konzept (Spitta 1992). Spitta, Gudrun (1992): Schreibkonferenzen in Klasse 3 und 4. Ein Weg vom spontanen Schreiben zum selbstbewussten Verfassen von Texten. Frankfurt am Main: Cornelsen Scriptor.
Schriftspracherwerb
Der Schriftspracherwerb ist ein Entwicklungs- und Lernprozess, der vor Schuleintritt beginnt und in verschiedenen Stufen verläuft. Auf den einzelnen Stufen werden die unterschiedlichen Schreib- und Lesestrategien zunehmend differenziert: Während in der frühen Phase die grundsätzliche Funktion der Schriftsprache thematisiert wird, geht es darauffolgend um die Regelhaftigkeit von Schriftsprache und die Berücksichtigung orthographischer Regeln. Der Übergang von einer Stufe auf die nächste ist dabei keineswegs fließend oder zeitlich festgelegt. Es gibt verschiedene Stufenmodelle der Schriftsprachentwicklung, die eine Auswahl der Möglichkeiten der Entwicklung der Schriftsprache von Kindern darstellen. Gemeinsam ist den Modellen die Annahme einer relativ systematischen Abfolge qualitativ unterschiedlicher kognitiver Prozesse. Das Erlernen von Lesen und Schreiben muss sich dabei nicht parallel entwickeln.
Screening
Ein Screening ist ein Verfahren vornehmlich zur Identifikation möglicher Entwicklungsrisiken bei Kindern, z.B. einer Lese-Rechtschreib-Störung. Es lassen sich auf der Basis von Screenings lediglich grobe Aussagen über mögliche Entwicklungsstände im betrachteten Leistungsmerkmal (z.B. Sprachfähigkeit), im Sinne dichotomer Einteilungen (z.B. Risiko ja/nein) treffen und keine differenzierten Leistungsmessungen vornehmen.
Semantisches System
Ein semantisches System ist ein kognitives Netzwerk, das Wissen und Bedeutung von Wörtern und Konzepten organisiert und verknüpft. Es bildet die Grundlage für die Verarbeitung und den Gebrauch von Sprache im Gehirn. Das semantische System ermöglicht die Assoziation von Wörtern mit Bedeutungen, die Interpretation von Sätzen und Texten sowie die Generierung von Bedeutungen in der
Sprachproduktion.
Sichtwortschatz
Der Sichtwortschatz enthält Wörter, die im Langzeitgedächtnis als Ganzheiten repräsentiert sind und deshalb nicht mehr Buchstabe für Buchstabe erlesen, sondern als Einheiten automatisiert erkannt werden können
Situationsmodell nach Kintsch
Das Situationsmodell nach Kintsch beschreibt den Prozess des Leseverstehens. Es basiert auf der These, dass das Textverstehen eine aktive Rekonstruktionsleistung ist, die über die im Text explizit genannten Informationen auch noch Vor- und Weltwissen und Schlussfolgerungen integriert, sodass das Bild, das sich Leserinnen und Leser von einem gelesenen Text machen, deutlich differenzierter und umfassender ist als die im Text benannten Informationen.
Sprachverstehen
(auch Sprachverständnis) Das Sprachverstehen definiert die Fähigkeit, die Bedeutung von sprachlichen Äußerungen zu entnehmen. Ein Kind benötigt altersgemäßes Sprachverstehen, um beispielsweise Aufforderungen wie „Zieh deine roten Schuhe an.“ ausführen zu können. Je älter die Kinder werden, desto komplexere Äußerungen können sie befolgen.
Stimmlose Laute/stimmhafte Laute
Stimmhaftigkeit: Ein stimmhafter Laut zeichnet sich dadurch aus, dass die Stimmlippen während der Lautproduktion schwingen. Stimmhafte Konsonanten sind beispielsweise /b/, /d/ und /g/. Beim Sprechen stimmhafter Konsonanten können die schwingenden Bewegungen der Stimmlippen am Kehlkopf erspürt werden. Vokale sind immer stimmhaft.
Stimmlosigkeit: Stimmhaftigkeit zeichnet sich durch nicht schwingende Stimmlippen bei der Lautproduktion aus. Stimmlose Konsonanten sind beispielsweise /p/, /t/ und /k/. Beim Sprechen stimmloser Konsonanten können keine schwingenden Bewegungen der Stimmlippen am Kehlkopf erspürt werden.
Super-/Makrostrukturen
Superstrukturen sind Textformen, welche Texte kennzeichnen und strukturieren. Jeder Text hat ein Thema (Makrostruktur) und eine Textform (Superstruktur). Der Text setzt sich aus Bestandteilen (Kategorien) zusammen. Ein Beispiel für eine Superstruktur ist die Textform „Politische Rede“.
Syntaktische Bewusstheit
Die syntaktische Bewusstheit bezeichnet die Fähigkeit, grammatische Mittel bewusst zu nutzen und über die Grammatik in einer Äußerung zu reflektieren, z.B. die Umstellung von Sätzen oder das Erfinden von Sätzen.
Syntaktische Fähigkeiten
Syntaktische Fähigkeiten beschreiben die Fähigkeit, Sätze grammatisch korrekt zu bilden und zu strukturieren. Hierzu zählen das Erkennen und die Anwendung von Satzbauregeln sowie die Verwendung von verschiedenen Satzarten und -strukturen.
Synthetisierendes Lesen
(auch verbindendes Lesen, phonologisches Rekodieren) Synthetisierendes Lesen bedeutet, dass Kinder die einzelnen Buchstaben eines Wortes in Laute umwandeln und diese dann koartikulatorisch verschmelzen können. Das ist eine Voraussetzung dafür, im Laufe der Grundschulzeit flüssig lesen zu lernen.
Testverfahren
Ein Testverfahren ist ein standardisiertes und normiertes Instrument zur Überprüfung einer Leistung, welches die Gütekriterien der Klassischen Testtheorie erfüllen sollte. Mit Tests lassen sich im Gegensatz zu Screenings differenzierte Aussagen über ein Leistungsmerkmal (z.B. Sprachfähigkeit, Lese-Rechtschreibleistung) treffen. Testverfahren sind entweder über einen Alters- oder Klassenstufenvergleich (soziale Bezugsnorm) oder über die Erfüllung eines bzw. mehrerer Kriterien (kriteriale Bezugsnorm) normiert.
Textsorten und Textmuster
Mit den Begriffen Textsorte und Textmuster versucht man Texte nach verschiedenen Merkmalen einzuteilen. Dabei bezeichnen Textmuster eher qualitative Aspekte von Texten: Für wen ist der Text geschrieben? Welche Handlung vermittelt der Text: informiert er, fordert er zu etwas auf, …? In welchem Stil ist er geschrieben? Nutzt er bestimmte Formulierungen? Mit Textsorten versucht man diese Aspekte zusammenzuführen. Eine Textsorte folgt gemeinsamen Textmuster. Textmustermischungen beziehen sich auf mehrere Textmuster. Sie sind in Alltagstexten häufig zu finden. (Fix 2011: 71,77) Fix, Ulla (2011): Texte und Textsorten - sprachliche, kommunikative und kulturelle Phänomene. Berlin: Frank & Timme. 2., durchges. Auflage.
Validität
(auch Gültigkeit) In der Testtheorie neben der Objektivität und Reliabilität ein Kriterium für die Testqualität: Ein Test ist valide, wenn er genau das misst, was er messen soll.
Vielleseverfahren
Vielleseverfahren sind eine Methode zur Leseförderung, bei der Kinder viele Texte lesen. Das kann etwa in freien Lesezeiten in der Schule geschehen oder auch mit dem „Buch der Woche“, das ein Kind für das häusliche Lesen auswählt und über das es der Klasse anschließend etwas erzählt oder zu dem es das Wichtigste für sich oder andere aufschreibt.
Vorläuferfähigkeiten
(auch Vorläuferfertigkeiten)
Vorläuferfähigkeiten sind Fähigkeiten, die für den Erwerb schulischer Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen von Bedeutung sind. In Bezug auf das Erlernen des Lesens können die phonologische Informationsverarbeitung (phonologische Bewusstheit, phonologisches Arbeitsgedächtnis, Benennungs-
geschwindigkeit), die Wortbewusstheit, die syntaktische Bewusstheit und die pragmatische Bewusstheit wichtige Einflussfaktoren sein. Diese unterstützen die Kinder bei Erwerb des Lesens.
Wortbewusstheit
Die Wortbewusstheit umfasst die Möglichkeit, Wörter als Segmente der gesprochenen Sprache zu erkennen. Kinder im Vorschulalter haben bereits ein implizites Wissen über Wortgrenzen, wenden dieses aber meist nur auf Wörter an, die konkrete Dinge benennen. Durch den regelmäßigen Umgang mit Schriftsprache können Kinder das Wissen auf andere Wortformen oder Funktionswörter übertragen.
Wortschatz
Der Wortschatz umfasst alle Wörter einer Sprache, die eine Person zum einen korrekt verstehen (passiver bzw. rezeptiver Wortschatz) und zum anderen beim Sprechen oder Schreiben nutzen kann (aktiver bzw. produktiver Wortschatz).
Zweitsprache
Als Zweitsprache wird eine Sprache bezeichnet, die eine Person nach ihrer Erstsprache bzw. ihrer Herkunftssprache erwirbt oder erlernt. Dies kann durch Sprachunterricht, Einwanderung in eine neue Sprachumgebung oder durch andere Erfahrungen erfolgen.